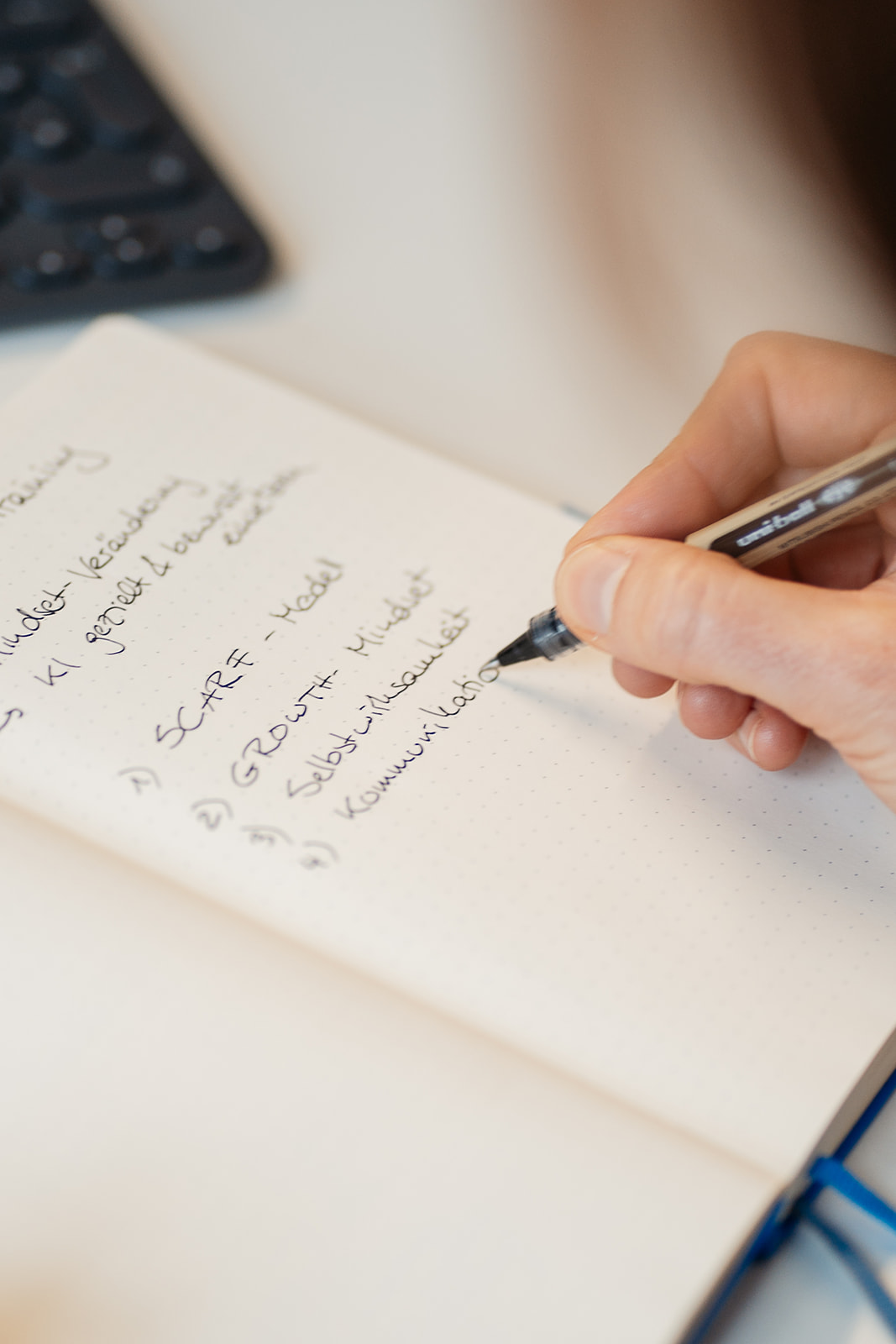Wenn Organisationen über die Einführung von KI nachdenken, stehen meist technische Fragen im Vordergrund: Tools, Daten, Algorithmen. Doch tatsächlich liegt die größte Herausforderung nicht in der Technik, sondern in unseren Köpfen und Herzen. Jede technologische Veränderung berührt uns Menschen emotional und löst oft unbewusste Ängste und Sorgen aus. Um diese Ängste besser zu verstehen, finde ich das SCARF-Modell des Neurowissenschaftlers David Rock unglaublich hilfreich. Es beschreibt fünf grundlegende soziale Bedürfnisse, die unser Gehirn ständig überprüft – oft ohne, dass wir es merken:
1. Status – „Bin ich noch wichtig, wenn KI kommt?“
Viele Menschen fragen sich, ob ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen noch gefragt sind, sobald KI Aufgaben übernimmt. Unser Gehirn interpretiert einen drohenden Statusverlust als echten Schmerz – Stress entsteht und blockiert die Bereitschaft, Neues anzunehmen.
2. Certainty (Sicherheit) „Was genau passiert mit meinem Wissen und meinen Daten?“
Unklarheit darüber, wie KI unsere Arbeit verändert, erzeugt Unsicherheit und Angst. Unser Gehirn mag keine Unsicherheit und reagiert darauf mit Stress. Transparente Kommunikation hilft, diesen Stress zu reduzieren und Vertrauen aufzubauen.
3. Autonomy (Autonomie) – „Kann ich weiterhin selbst bestimmen, was mit meiner Arbeit passiert?“
Der Verlust an Kontrolle ist für uns Menschen besonders schwierig. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, Entscheidungen nicht mehr selbst treffen zu können, entsteht Widerstand und Frustration. Deshalb ist es wichtig, Beteiligung und Mitgestaltung zu ermöglichen.
4. Relatedness (Beziehung) – „Bleibe ich weiterhin Teil meines Teams oder werde ich isoliert?“
KI kann das Gefühl sozialer Zugehörigkeit beeinträchtigen. Unser Gehirn reagiert auf soziale Isolation genauso stark wie auf körperlichen Schmerz. Gemeinsamer Austausch und Teamarbeit bleiben daher entscheidend, um Verbundenheit zu fördern.
5. Fairness – „Geht man mit meinem Wissen fair um oder wird es ausgenutzt?“
Ungerechtigkeit oder das Gefühl, unfair behandelt zu werden, erzeugt intensive negative Emotionen. Wenn Mitarbeitende befürchten, dass KI ihr Wissen unfair nutzt, ist Frust vorprogrammiert. Klare Regeln und transparente Prozesse schaffen hier Sicherheit.
Den Menschen verstehen, um KI erfolgreich einzuführen
Das SCARF-Modell macht deutlich, wie wichtig es ist, bei Veränderungen zuerst den Menschen im Blick zu haben. Nur wenn wir verstehen, was emotional und neuropsychologisch passiert, können wir Mitarbeitende erfolgreich durch Veränderungen begleiten und sie positiv für KI gewinnen.
Praktische Tipps für deine KI-Projekte:
- Status stärken: Erkläre, wie KI vorhandene Kompetenzen ergänzt und bereichert.
- Sicherheit schaffen: Kommuniziere klar und offen, was genau mit den Daten und Wissen geschieht.
- Autonomie ermöglichen: Gib Mitarbeitenden Raum, KI-Prozesse aktiv mitzugestalten.
- Verbundenheit fördern: Sorge für Austauschmöglichkeiten und fördere den Teamgedanken.
- Fairness leben: Etabliere transparente Regeln und faire Bedingungen für den Einsatz von KI.
KI wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir die Menschen und ihre Bedürfnisse ernst nehmen und aktiv berücksichtigen.
Ich freue mich über deine Gedanken und Erfahrungen zum Thema SCARF-Modell und KI-Einführung. Lass uns gerne ins Gespräch kommen!